Sprachen
Deutsch
Fachschaftsleitung: Marie Sienkiewicz
DEUTSCH AM ALBERTUS - das Fach Deutsch stellt sich vor:
Kurz auf den Punkt gebracht kreist der Unterricht im Fach Deutsch um das Lesen, das Schreiben und das Sprechen – also um ganz grundlegende Fertigkeiten, die jeder von uns in seinem alltäglichen Leben benötigt. Mit Hilfe der Sprache bilden wir unsere Gedanken ab, erschließen die Wirklichkeit und treten mit unseren Mitmenschen in Kontakt. ,,Sprache ist“, wie Wilhelm von Humboldt so treffend erklärt hat, ,,der Schlüssel zur Welt“. Insofern handelt es sich beim Lesen, Schreiben und Sprechen auch um Fähigkeiten, auf die alle anderen Fächer zurückgreifen und die noch im Studium, in der Ausbildung und im Berufsleben eine entscheidene Rolle spielen. Diese drei Schlüsselkompetenzen beständig zu erweitern und zu verfeinern, stellt das zentrale Anliegen des gymnasialen Deutschunterrichts dar.
Marie Sienkiewicz
Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht die Auseinandersetzung mit Sprache und Literatur. Die Schüler erlernen Techniken und Methoden, um flüssig, vertieft und deutend zu lesen, die Vielschichtigkeit von Aussagen zu entschlüsseln und Texte sachgerecht zu erschließen. Dabei setzen sie sich – vom Kochrezept über das klassische Theaterstück und den spannenden Thriller bis hin zur naturwissenschaftlichen Abhandlung – mit den verschiedensten Arten und Ausprägungen geschriebener Sprache auseinander. Bis zum Abitur schärfen sie ihr ästhetisches Urteilsvermögen, indem sie filmische Gestaltungsmittel analysieren, Jugendromane, Graphic Novels oder andere Werke der Weltliteratur interpretieren und alle Epochen der deutschen Literaturgeschichte kennenlernen. Außerdem festigen sie ihre Medienkompetenz, indem sie unterschiedliche - selbstverständlich auch digitale - Medien nutzen, deren Vor- und Nachteile erörtern und bei Recherchearbeiten zu einem kritischen Umgang mit Informationen angeleitet werden. Dadurch dass unsere Schüler fortwährend selbst - zunächst erzählende und schildernde, dann informierende, argumentierende und in den höheren Jahrgangsstufen auch interpretierende und wissenschaftliche - Texte anfertigen und überarbeiten, erweitern sie ihr eigenes Ausdrucksvermögen und erwerben das Handwerkszeug zum wissenschaftlichen Arbeiten. Auch aufgrund einer intensiven Erforschung des Wesens der Sprache erfassen sie die Vielfalt sprachlicher Möglichkeiten und lernen, sich - schriftlich wie mündlich - strukturiert, richtig, verständlich, differenziert und adressatenbezogen zu äußern. Beim Rezitieren von Gedichten und Halten von Referaten gewöhnen sie sich daran, vor Gruppen zu sprechen; beim Inszenieren von Märchen, Balladen und Dramenszenen sammeln sie erste Bühnenerfahrungen. Außerdem lernen sie im alltäglichen Unterrichtsgespräch, in Podiumsdiskussionen und Debatten, begründet Stellung zu nehmen, rhetorisches Geschick zu entfalten und einen Standpunkt überzeugend zu vertreten. Schließlich sollen sich die Heranwachsenden zu mündigen, kreativen, selbstbewussten, urteilssicheren und wortgewandten Menschen entwickeln, die in der modernen Medienwelt ihren eigenen Weg gehen.
Marie Sienkiewicz
Freude am Lesen und Begeisterung für Kultur zu wecken, liegt uns Deutschlehrkräften ganz besonders am Herzen. Deswegen sorgen wir auch außerhalb des Klassenzimmers für vielfältige Anregungen, indem wir zeitgenössische Autoren und Referenten zu Lesungen und Vorträgen in den schuleigenen Theaterkeller einladen, regelmäßig an Wettbewerben und Aktionen wie beispielsweise dem bundesweiten Vorlesetag oder dem ARD-Jugendmedientag teilnehmen, fächerübergreifende kreative Projekte wie ,Gelebte Gedichte’ ausrichten und gemeinsame Museums-, Bibliotheks-, Theater- und Kinobesuche organisieren. Ein besonderes Highlight des AGLs stellt die einwöchige Bildungsfahrt nach Weimar dar, die in Zusammenarbeit mit der Weimarer Klassik-Stiftung alljährlich in der Oberstufe durchgeführt wird. Anstatt nur die Werke Goethes und Schillers zu lesen, können die Jugendlichen hier unter fachkundiger Anleitung selbst auf den Spuren der beiden berühmtesten deutschen Dichter wandeln, Beispiele der NS- und DDR-Architektur erkunden und sich mit lebendigen Zeugnissen der Geschichte auseinandersetzen. Bei der Klassik-Stiftung handelt es sich jedoch längst nicht um den einzigen außerschulischen Kooperationspartner, von dem unsere Schüler profitieren. So erleben und gestalten sie durch unsere Teilnahme am ,,Jugend-debattiert“-Projekt der Hertie-Stiftung, das am AGL in Form zweier mündlicher Deutsch-Schulaufgaben in der Mittelstufe verankert ist, demokratische Prozesse hautnah mit. Im Bereich der Medienpädagogik arbeiten wir im Rahmen des ZiSCH-Projekts, das unseren Schülern nicht nur eine kostenlose Zeitungslektüre ermöglicht, sondern auch journalistische und publizistische Grundsätze vermittelt, mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung zusammen. Darüber hinaus stellen wir ihnen durch unser Schulabonnement des Archivs der Süddeutschen Zeitung eine Datenbank zur Verfügung, die eine gezielte und umfassende Recherchearbeit ermöglicht. Auch für die Seminare der Oberstufe gewinnen wir immer wieder geeignete Kooperationspartner, zu denen unter anderem das Heinz-Piontek-Museum oder die theaterpädagogische Abteilung des Staatstheaters Augsburg gehören. Nicht zuletzt nehmen unsere sechsten Klassen jedes Jahr am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels teil, der zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben zählt. Die Jury im Schulentscheid setzt sich dabei auch aus externen Mitgliedern wie Vertetern der Lauinger Stadtbücherei und der Dillinger Buchhandlung Brenner zusammen, die uns ganz maßgeblich unterstützen. Zudem bietet das AGL interessierten Schülern neben einer gut sortierten und gemütlich eingerichteten Schülerlesebücherei, die in den Pausen ihre Pforten zum Schmökern und zur kostenlosen Ausleihe öffnet, auch den Wahlunterricht Schülerzeitung und eine Theater-AG, in der man Bühnenluft schnuppern und sein Schauspieltalent vor einem größeren Publikum unter Beweis stellen kann.
Marie Sienkiewicz
Englisch
Fachschaftsleitung: Johannes Reichhart
Fordern und Fördern in Englisch
Englisch begleitet die meisten Gymnasiasten ein Schülerleben lang – von der 5. Klasse bis zum Abitur. Über die Jahre entwickeln sie kommunikative Kompetenzen, interkulturelle Kompetenz sowie Text- und Methodenkompetenz. In Englisch gibt es dabei ein paar Besonderheiten:
- Die Betonung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit: auch wenn es anfangs nicht immer und jedem leicht fällt, ermuntern wir alle Schülerinnen und Schüler, sich im Unterricht und darüber hinaus auf Englisch zu verständigen und die Scheu vor der Fremdsprache abzulegen. In der 6. und 9. Klasse sowie in der Oberstufe wird jeweils eine Schulaufgabe als mündliche Partnerprüfung gestaltet
- In bayernweit zentralen Jahrgangsstufentests stellen die Schülerinnen und Schüler zu Beginn der 7. und 10. Jahrgangsstufe ihr Können in Englisch unter Beweis
- In allen Jahrgangsstufen gibt es neben den von erfahrenen Schülern angebotenen Lerninseln auch gezielte Förderangebote durch Fachlehrkräfte.
- Wer die 11. Jahrgangsstufe im Rahmen der Individuellen Lernzeitverkürzung überspringen möchte, belegt in der 9. und 10. Jahrgangsstufe u.a. Module im Fach Englisch. Auch ein Auslandsaufenthalt ist während der 11. Klasse möglich
- Für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler gibt es in der Oberstufe einen Kurs zur Vorbereitung auf das C1 Advanced exam (CAE)
- In der Qualifikationsphase wird Englisch am Albertus-Gymnasium sowohl auf grundlegendem Anforderungsniveau (gA) mit drei Wochenstunden als auch auf erhöhtem Anforderungsniveau (eA) mit fünf Wochenstunden angeboten
Johannes Reichhart
Informationen zum CAE für interessierte Kandidaten
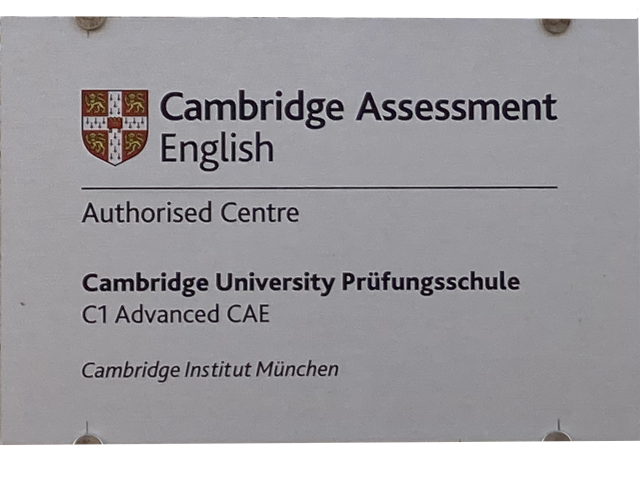 Die Prüfungen zum Cambridge Certificate of Advanced Englisch richten sich an alle Schüler*innen der Oberstufe, die dieses Zertifikat als zusätzliche und international anerkannte Qualifikation erwerben wollen.
Die Prüfungen zum Cambridge Certificate of Advanced Englisch richten sich an alle Schüler*innen der Oberstufe, die dieses Zertifikat als zusätzliche und international anerkannte Qualifikation erwerben wollen.
Es handelt sich um eine Sprachprüfung auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER), durch die der für die Aufnahme eines Studiums in englischsprachigen Ländern benötigte Sprachnachweis für eine Vielzahl von Universitäten und universitären Einrichtungen erbracht werden kann.
Die Prüfung wird in 130 Ländern angeboten und umfasst die vier Prüfungsteile Reading and Use of English, Writing, Listening und Speaking.
Die Anmeldefrist: 15.12.2025.
Termine: 14.3.2026 mündliche Prüfung, 21.3.2026 schriftliche Prüfung
Johannes Reichhart
Das AGL bietet mit Wirtschaftsenglisch eine Zusatzqualifikation für alle Schülerinnen und Schüler in der Qualifikationsphase an. Neben der Verbesserung der Gesprächskompetenz geht es in diesem Kurs auch um Hintergrundwissen aus dem Bereich des Marketing, kulturelle Gepflogenheiten im angelsächsischen Wirtschaftsraum und natürlich auch um das Verfassen von Bewerbungsunterlagen für Adressaten in Großbritannien oder den USA und Kanada.
Johannes Reichhart
Französisch
Fachschaftsleitung: Sabine Werner
Latein
Fachschaftsleitung: Maria Zehentmeier
Unsere Schüler lernen ab der 6. Jahrgangsstufe entweder Latein oder Französisch. Der Lateinunterricht gliedert sich in Lehrbuchphase und Lektürephase.
1. Lateinunterricht im G 9
|
Jahrgangsstufe 6 |
Lehrbuchphase Sprach- und Kulturunterricht mit dem Lehrwerk Campus |
|
Jahrgangsstufe 91 |
Literaturunterricht z. B. Epigramme von Martial, Ausschnitte aus Cäsars Bellum Gallicum, eine Rede von Cicero, Briefe des Plinius, Gedichte des Catull, philosophische Texte, Cena Trimalchionis in Petrons Satyrica, Passagen aus Vergils Äneis ... |
|
Jahrgangsstufe 113 |
1 Wer im Jahreszeugnis mindestens eine Vier erreicht, hat das Kleine Latinum.
2 Wer im Jahreszeugnis mindestens eine Vier erreicht, hat das Latinum.
3 Ein Schüler kann nach der 10. Jahrgangsstufe Latein ablegen und stattdessen in der 12. und 13. Jahrgangsstufe spät beginnendes Französisch erlernen.
4 In der Qualifikationsphase der Oberstufe kann Latein ein Jahr (in der 12. Jahrgangsstufe) oder zwei Jahre (in der 12. und 13. Jahrgangsstufe) belegt werden.
2. Literaturunterricht im G8 (ab Schuljahr 2020/21)
|
Jahrgangsstufe 91 |
Literaturunterricht z. B. Epigramme von Martial, Ausschnitte aus Cäsars Bellum Gallicum, eine Rede von Cicero, philosophische Texte, Cena Trimalchionis in Petrons Satyrica, Passagen aus Vergils Äneis ... |
|
Jahrgangsstufe 113 |
1 Im G8: Nach der 9. Jahrgangsstufe kann ein Schüler Latein ablegen und stattdessen spät beginnendes Französisch bis zum Abitur belegen.
Wer im Jahreszeugnis mindestens eine Vier erreicht, hat das Kleine Latinum.
2 Im G8: Nach der 10. Jahrgangsstufe ist es möglich, Latein abzulegen.
Wer im Jahreszeugnis mindestens eine Vier erreicht, hat das Latinum.
3 In der Oberstufe kann Latein ein Jahr (in der 11. Jahrgangsstufe) oder zwei Jahre (in der 11. und 12. Jahrgangsstufe) belegt werden.
Maria Zenhentmeier
- Grundkenntnisse (Kulturwissen)
Wie lebten die Römer? Was glaubten sie? Was dachten sie? Welche unserer kulturellen Errungenschaften, Traditionen und Ansichten haben ihre Wurzeln in der Antike?
Diese und ähnliche Fragen werden im Lateinunterricht gestellt. Im Anhang ist Kulturwissen zusammengefasst, das im Lateinunterricht an unserer Schule in der jeweiligen Jahrgangsstufe behandelt wird. Es basiert auf dem vom ISB vorgelegten Grundwissen und wurde von der Fachbereichsleiterin auf unsere Region und das Lehrbuch unserer Schule abgestimmt und illustriert.
Aufgabenbeispiele zum Kulturwissen können heruntergeladen werden unter www.isb.bayern.de/download/11932/kompetenzorientierte_aufgabenbeispiele_latein.pdf. Ein Erwartungshorizont zu den Aufgaben findet sich unter folgender Adresse: www.isb.bayern.de/download/11934/erwartungshorizonte_latein.pdf.
Grundkenntnisse Kulturwissen
- Kulturwissen 6. Jahrgangsstufe (Grundkenntnisse)
- Kulturwissen 7. Jahrgangsstufe (Grundkenntnisse)
- Kulturwissen 8. Jahrgangsstufe (Grundkenntnisse)
- Kulturwissen 9. Jahrgangsstufe (Grundkenntnisse)
- Kulturwissen 6., 7., 8., 9. und 10. Jahrgangsstufe (Grundkenntnisse)
- Kulturwissen 6. und 7. Jahrgangsstufe (Grundkenntnisse)
Maria Zehentmeier
